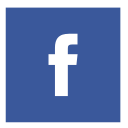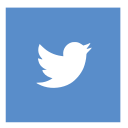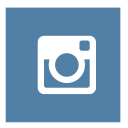Die dritte Geschichte, aus dem Finale des Schreibwettbewerbs im November.
Ein ganzes Leben später
Mitten in unserem Wohnzimmer stehe ich vor einem Bilderrahmen.
Ich lese, vielleicht zum tausendsten Mal, die Zeilen auf einem
vergilbten Stück Pergament, welches dort eingerahmt an der Wand
hängt.
Während ich Satz für Satz in mir aufsauge, versinke ich ganz in
Gedanken. Eine Welle aus Erinnerungen holt mich ab und bringt mich
zurück an einen Tag, vor ziemlich genau drei Jahren:
„Ich glaub es nicht, das darf doch echt nicht wahr sein!“,
fluche ich und ziehe vorsichtig meinen Schuh aus der knöcheltiefen
Pfütze. Prompt merke ich, wie sich das kalte Wasser bereits durch
das Leder frisst und meine Zehen erfrieren lässt.
Schwungvoll rolle ich das kleine Pergamentbriefchen zusammen
und stecke es anschließend behutsam in meine Manteltasche.
Auf einem Bein hüpfend, krame ich nun in den Tiefen meiner
Handtasche nach einem Taschentuch, um zumindest die Oberfläche
meins Pumps trocken zu wischen. Offenbar habe ich mir für diesen
Trip äußerst ungeeignetes Schuhwerk ausgesucht.
Gerade verliere ich die Balance, da fassen mich im richtigen
Moment zwei kräftige Hände am Ellenbogen und verhindern so, dass
ich komplett in die Pfütze falle. Erstaunt blicke ich auf und
gucke direkt in zwei honigfarbene Augen. Ich bin verdutzt, solch
ein schönes Augenpaar habe ich nicht erwartet. Ich lasse meinen
Blick an dem dazugehörenden menschlichen Wesen einmal von oben
nach unten gleiten. Die Augen gehören zu einem dunkelhaarigen
männlichen Prachtexemplar, ungefähr in meinem Alter und dazu mehr
als sexy. Was für ein Mann!
„Na hoppla junge Frau, das wäre ja fast schief gegangen!“,
grinst mein Retter mich an. Seine tiefe Stimme hat einen rauen
Ton, der mir eine Gänsehaut auf den Armen bereitet. An der Stelle,
an der mich seine beiden Hände immer noch stützen, kribbelt meine
Haut. Sogar durch den dicken Mantel.
Statt irgendetwas zu sagen, wie es jetzt wohl angebracht wäre,
starre ich nur weiter. Diese Honigaugen haben mich völlig in ihren
Bann gezogen.
Durch die ganze Guckerei auf den heißen Typen bekomme ich glatt
weiche Knie.
Ich denke nicht nach. Ich brauche schleunigst wieder Halt,
sonst gleite ich hier vor den Augen meines Retters zu Boden.
Schnell setze ich meinen zweiten Fuß, den ich immer noch
angewinkelt halte, auf dem Erdboden auf.
„Nein!“, keuche ich. Da war ja noch was: Diese Pfütze, welche
ja der Ursprung des ganzen Übels war. Schlagartig holt mich der
Schwall Eiswasser, welcher über den Rand des Pumps schwappt,
zurück in die Realität. Mein Fuß ist vollends baden gegangen. Was
soll ́s, wenigstens finde ich so die Sprache wieder.
„Ach es tut mir leid!“, lache ich. Endlich besinne ich mich auf
meine guten Manieren und strecke meinem Helfer die rechte Hand
hin. „Ich bin Lena!“
„Ramon!“, antwortet der schnurrend, lässt meinen Ellenbogen los
und schüttelt meine Hand. Ramon hat einen angenehmen Händedruck,
der zu ihm passt. Nichts ist mir mehr zuwider als einen
Waschlappen zu halten.
Just in diesem Moment öffnet der Himmel wieder einmal seine
Schleusen. Seit Tagen klart es nicht mehr auf und zu den
ungünstigesten Zeiten ergießen sich unbarmherzige Schauer über
die Menschen auf den Straßen. Im Augenwinkel kann ich sehen, wie
die Passanten um uns herum hektisch in alle Richtungen laufen, um
Schutz zu suchen.
„Ja dann,“, sage ich verlegen. „Vielen Dank, dass Sie mich vor
der Pfütze gerettet haben!“
„Gerne doch. Wir sollten schleunigst ins Trockene. Wie sieht es
aus, haben Sie Lust auf eine tolle Tasse Kaffee? Sie trinken doch
Kaffee?“ Ramon hält sich mittlerweile schützend eine schwarze
Aktentasche über den Kopf.
„Äh ja, aber woher wissen Sie..?“.
Er zeigt auf den leeren Pappbecher, welcher aus meiner
Handtasche lugt.
Ich muss lachen. „Scharf kombiniert!“
„War nicht besonders schwer. Gleich dort drüben ist ein
niedliches Café, also? Ich mag nicht so gerne Platzregen!“
Ich muss nicht lange überlegen: „Na dann los!“
Schon läuft Ramon in die Richtung des von ihm angepriesenen
Cafés.
So schnell ich mit meinen Pumps rennen kann, folge ich ihm
durch den prasselnden Herbstregen.
Ramon hat mich in ein irrsinnig niedliches Bistro geschleust.
Schon beim Betreten empfing uns eine behagliche Wärme und mir
schlug der Geruch von frisch gemahlenen Kaffeebohnen entgegen.
Passenderweise haben wir einen Tisch in einem kleinen Séparée mit
Blick auf die Straße ergattern können.
„Puh, das ist ja ein Wetter!“, schnaufe ich, während ich meinen
nassen Mantel über die Stuhllehne hänge. Kaum habe ich mich
hingesetzt, steht auch schon eine Tasse dampfender Cappuccino vor
mir. Ich lege beide Hände um die heiße Tasse und atme tief den
verführerischen Duft ein. Herrlich, das ist jetzt genau das
Richtige!
„Ja, das kann man laut sagen! Mir reicht dieses Wetter auch
langsam.“, stimmt mir Ramon mit einem Blick nach draußen zu. Nur
einen Augenblick später sind seine Honigaugen wieder auf mich
gerichtet. „Was haben Sie denn bei dem Hundewetter dort draußen
gemacht?“
„Du.“, sage ich und koste den ersten Schluck des Cappuccinos.
Ramon hatte nicht übertrieben, das Heißgetränk schmeckt einfach
göttlich.
„Bitte?“
Ich muss lachen. „Ich finde, wir können beim Du bleiben, falls
du nichts dagegen hast!“ Ramon nickt und zeigt mir wieder sein
schönes Lächeln. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich
denken, dass dieser Mann gerade von einem Kalendercover gesprungen
ist.
Seine noch feuchten, schwarzen Locken fallen ihm verwegen in
die Stirn. Der Dreitagebart und der dunkle Teint bilden den
perfekten Kontrast zu diesen außergewöhnlich hellen Augen.
Unter seinem Blick wird mir kribbelig warm. Erst hier drinnen
habe ich Ramon komplett begutachten können. Unter seiner Jacke
trägt er ein lässiges dunkelgraues Longsleeve, dazu eine schlichte
Jeans. Beides gerade so eng, dass man seinen durchtrainierten
Körper erahnen kann.
Ich reiße mich widerwillig von seinem Adoniskörper los und
fange an zu erzählen: „Ach das ist eine ganz verrückte Geschichte.
Aber sicher viel zu lang.“
Ramon nimmt nun auch einen Schluck seines Kaffees und zieht die
Augenbrauen hoch. „Ich hab Zeit!“
Okay, wo fange ich an? Ich beiße mir auf die Unterlippe und
überlege kurz.
„Na gut,“, setze ich endlich an. „Also kurz vorweg: Mein
Exfreund und ich haben uns vor acht Monaten getrennt. Und in
meinem Alter fahren eben nicht mehr alle Freundinnen spontan mit
einem in den Urlaub, also hatte ich mir überlegt, einfach alleine
zu verreisen. Bei dem Wetter hier…“, ich schaue durch das große
Fenster auf die Straße, wo es junge Hunde regnet. „Bei dem Wetter
hier konnte mir etwas Sonne, Strand und Meer nicht schaden.“
„Kann ich verstehen!“, nickt Ramon. „Und, wo warst du?“
„Portugal“. Ich nehme noch einen Schluck des Cappuccinos.
„Oh schön, da wollte ich immer mal hin!“
Ich nicke begeistert. „Ja, es war wirklich ein Traum. Das
Wasser glasklar, man kann da echt noch Fische sehen und die
Strände sind einfach nur wow. Ich konnte mich gar nicht sattsehen
an den ganzen Surfern.“
Während ich von meinem Urlaub schwärme, fällt mir der Ursprung
meines Besuches in Hamburg wieder ein: das zusammengerollte Stück
Pergament in meiner Manteltasche. Ich komme zurück zum Punkt.
„Ja und nun der eigentliche Grund, warum ich dort draußen
herumstand: Eines mittags, als ich einen kleinen Spaziergang am
Strand gemacht habe, da schwamm nahe des Ufers eine alte Flasche.
Ich habe mich echt geärgert, dass irgendein Tourist seinen Müll
wieder einmal in diese wunderschöne Natur schmeißt. Auf jeden Fall
habe ich mir die Flasche geholt und wollte sie im nächsten
Mülleimer entsorgen.“
Ramon guckt mich fragend an. „Und?“
Ich ziehe das kleine, vergilbte Pergament aus meiner
Manteltasche und rolle es zwischen uns auf dem Tisch aus.
„Tja, es war kein Müll, es war eine Flaschenpost!“
Ramon lacht lauthals los. „Ich glaub es nicht. Das ist bestimmt
so ein Touristenteil, was man als Andenken mitnehmen kann! Das
gibt es doch in jedem Touri-Laden zu kaufen.“
Ich schüttele energisch den Kopf. „Das dachte ich zuerst auch.
Aber als ich dann das Briefchen herausgeholt hatte, da wurde mir
klar, dass es eine Echte sein muss!“
Ich schiebe das Blatt näher zu Ramon.
Für einige Sekunden huschen seine Augen über die kleine
Schrift. Mit jedem Wort steht ihm die Verwunderung tiefer ins
Gesicht geschrieben.
Nachdem er den Brief gelesen hat, blickt er kurz auf und sieht
mich an. Dann liest er die Flaschenpost erneut.
Ich selbst habe den kleinen Brief in den letzten Wochen so oft
gelesen, dass ich die Nachricht mittlerweile auswendig kenne.
Me amore Annelie,
ich weiß nicht, ob dich diese Zeilen jemals erreichen werden,
aber ich muss es versuchen.
Heute ist der 15. April 1950 und wir befinden uns mit unserem
Containerschiff mitten im Atlantischen Ozean.
Ein schlimmer Sturm hat die Hälfte der Crew letzte Nacht über
Board gespült, wir konnten sie nicht retten. Zwei unserer drei
Motoren sind defekt und im Frachtraum ist ein großes Leck. Unsere
Vorräte gehen zur Neige. Wenn sich das Wetter nicht bald bessert,
weiß ich nicht, wie wir das überstehen sollen. Ich habe Angst,
dass ich nicht lebend zurückkomme.
Falls du diese Zeilen erhalten solltest, sollst du wissen, dass
ich mit einem Gedanken gestorben bin: Und das war der Gedanke an
dich!
Wir hatten viel zu wenig Zeit, aber es war die Schönste meines
Lebens, ich bereue keine Sekunde, das musst du wissen!
Pass gut auf unseren Jungen auf!
Te amo,
dein Emilio R. Frascuelo
Nachdem Ramon den Brief erneut gelesen hat, blickt er
nachdenklich auf. Lange Zeit sagt er gar nichts und starrt nur aus
dem Fenster auf die Straße. An seinem Gesichtsausdruck erkenne
ich, dass in ihm etwas zu rumoren scheint.
Nach einer Weile versuche ich, das Schweigen zu brechen.
„Ja,“, setze ich an. „Und nun suche ich die Frau des Absenders
oder zumindest die Hinterbliebenen von Emilio R. Frascuelo. Ich
finde, dass sie seine Nachricht erhalten sollten!“
Ramon sagt immer noch nichts und so langsam irritiert mich das
doch ein wenig. Bin ich ihm mit irgendetwas zu nahe getreten?
Ich erzähle einfach weiter: „Dank des Internets konnte ich
herausfinden, dass es hier in Hamburg eine Familie Frascuelo gibt.
Ich musste also Nichtmal allzuweit fahren. Vielleicht habe ich ja
Glück.“
„Ja vielleicht!“, murmelt Ramon.
Seit er diesen Brief gelesen hat, ist er irgendwie merkwürdig.
Schade, bislang dachte ich, dass meine Zuneigung zu diesem Mann
vielleicht auf Gegenseitigkeit beruhen könnte. Vermutlich habe ich
mir das Knistern zwischen uns nur eingebildet und er wollte
einfach nur nett sein, als er mich zum Kaffee eingeladen hat.
Ich räuspere mich, als ich sein Schweigen nicht mehr aushalte.
„Ist alles in Ordnung?“
„Lena, glaubst du an Schicksal?“, fragt Ramon und sieht mich
direkt an. Mir läuft wieder ein Schauer den Rücken herunter. Ich
zucke mit den Schultern und schaue geradewegs in seine Honigaugen.
„Ich… ich weiß es nicht.“, sage ich langsam.
Keiner von uns wendet den Blick ab. Ich habe das Gefühl mit
jedem Atemzug tiefer in Ramons Augen zu tauchen. Es knistert so
sehr zwischen uns, dass es mich wundert, dass keine Funken
sprühen.
Nein, ich habe es mir nicht eingebildet: Dieser Mann findet
mich genauso anziehend, wie ich ihn.
„Ich habe nicht an das Schicksal geglaubt, Lena…“, flüstert
Ramon fast und wendet abrupt den Blick ab. Dann trinkt er den
letzten Schluck aus seiner Kaffeetasse.
„Aber?“, frage ich.
„Ich habe bis eben nicht an das Schicksal geglaubt.“, das
„eben“ betont er dabei besonders. „Allerdings muss ich zugeben,
dass ich meine Meinung vielleicht ändern muss.“
Ich verstehe nur Bahnhof. Ramon scheint meine Verwirrung zu
bemerken.
„Willst du mal was sehen?“, fragt er.
Ich bin gespannt, was nun kommt. „Was denn?“, antworte ich
schlicht.
Ramon steht auf und zieht seine Geldbörse aus der Gesäßtasche
seiner Jeans. Dann holt er eine kleine Scheckkarte hervor und
reicht sie mir.
Ich halte den Ausweis von Ramon in meinen Händen. Zunächst
springt mir nur sein Foto ins Auge: Dieser unglaublich schöne Mann
mit den außergewöhnlichsten Augen, die ich je gesehen habe.
Nachdem ich das Bild ausgiebig betrachtet habe, gucke ich ihn
fragend an. Mir ist nicht klar, worauf er hinaus will.
„Lies meinen Namen.“
Mir fällt im wahrsten Sinne des Wortes fast die Kinnlade
herunter. „Ramon Emilio Frascuelo“ steht da. Ich blicke kurz auf
und lese dann nochmal, weil ich es nicht glauben kann: „Ramon
Emilio Frascuelo“. Schwarz auf weiß ist dort dieser Name
abgedruckt.
„Das… Das kann nicht… Was?“, mir fehlen zum zweiten Mal an
diesem Tag die Worte.
„Das dachte ich auch zuerst, als ich die Flaschenpost gelesen
habe.“ Ramon findet also so langsam seine Sprache wieder.
Wenigstens einer von uns.
„Emilio R. Frascuelo war mein Großvater. Das „R.“ steht für
Ramon.“, eröffnet er mir.
Ich kann es immer noch nicht fassen. „Bist du dir sicher?“,
frage ich.
„Absolut. Mein Opa war Spanier und lebte mit meiner Oma Annelie
Frascuelo in Kiel. Er ist aus Spanien wegen ihr nach Deutschland
gekommen und war bei einer kleinen Firma angestellt. Sie
verschifften Container quer durch die gesamte Welt. 1950 kam er
dabei bei einem Sturm ums Leben, nichts Genaues wusste man. Damals
war mein Vater gerade zwei Jahre alt.“, Ramon erzählt so, als wenn
er diese Geschichte schon oft wiederholt hätte. Ich staune
Bauklötze.
„Ja, und weil in Kiel alles voller Erinnerungen war, ist meine
Großmutter kurz nach Opas Tod nach Hamburg gezogen. Und in
Gedenken an meinen Opa haben sie mich nach ihm benannt, allerdings
die Namen in vertauschter Reihenfolge.“ Ramon schiebt mir den
Brief wieder zu.
„Das gibt es doch nicht!“, sage ich.
Ramon grinst zuerst und fängt dann lauthals an zu lachen. „Ich
würde sagen, dass du die Nachfahren deines Absenders der
Flaschenpost gefunden hast: Mich!“, dabei tippt er sich selbst mit
dem Daumen gegen die Brust. „Tja Lena, ich schätze, dass es kein
Zufall sein kann, dass gerade ich dich vor dieser gefährlichen
Pfütze gerettet habe.“
Auch ich stimme in sein Lachen ein: „Nein Ramon, du hast Recht.
Das muss das Schicksal gewesen sein!“
Ohne Vorwarnung werde ich aus meinen Erinnerungen gerissen, als
sich zwei kräftige Arme um mich schlingen. Ich habe ihn nicht
kommen hören. Sanft werde ich gedreht, bis ich in die schönsten
Augen der Welt blicke: in die Honigaugen meines Mannes Ramon.
„Na, betrachtest du wieder einmal Opas Andenken?“, schnurrt
mein Liebster.
„Ja, manchmal muss ich dran denken, wie alles angefangen hat
mit uns…“, seufze ich verträumt.
„Ich würde sagen, dass Opa bestimmt froh und glücklich wäre.
Wenn der wüsste, dass seine Flaschenpost 63 Jahre später die große
Liebe zu seinem Enkel geschickt hat. Er wäre sicher stolz.“
Ich kann nicht anders: Ich nehme Ramons Gesicht zwischen meine
Hände und gebe ihm einen leidenschaftlich, innigen Kuss.
Gerade schlingen wir die Arme umeinander, da hören wir es:
„Mamaaaa, Papaaa!“, quäkt es lauthals aus der Küche.
„Ja Emilio Frascuelo Junior, du kleines Monster, wir kommen!“
Ramon und ich lösen uns etwas wehleidig aus unserer Umarmung. Ich
werfe einen letzten Blick auf die schicksalhafte Flaschenpost,
lächle und nehme meinen Mann an die Hand. Diese Familie lasse ich
nie wieder gehen!
»Ein ganzes Leben später«