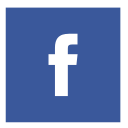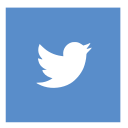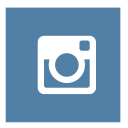Und nun kommen wir heute schon zur dritten Story, die es ins Finale geschafft hat. Vielen Dank Mandy Schmidt für Deine Einsendung.
Viel Spaß beim Lesen,
Euer Lounge Team
Let Me Out von Mandy Schmidt (poetic mind)
Wörter insgesamt: 2759
Mein Blick schweifte verzweifelt aus dem Fenster, vor dem ich stand.
Zart berühren meine Finger die kalte Scheibe.
Die Taubheit bohrte sich geradewegs weiter in meine Glieder, andererseits störte es mich irgendwie gar nicht mehr.
Ich hatte schon vor langer Zeit aufgehört darunter zu leiden.
Das ich überhaupt noch etwas fühlte, war ein Wunder.
Draußen stürmte es nur so vor sich her. Die Kronen der Bäume tanzten im Wind. Blätter wehten wild durch die Lüfte. Vögel, die sich eilig einen Unterschlupf suchten, um sich vor dem Regenguss in Sicherheit zu bringen.
Ich hingegen saß in diesem Raum.
Die Wände kamen immer näher, wollten mich regelrecht erschlagen. Der Putz abgefallen, grau und verkommen.
Es war kaum noch zu verkraften.
Manchmal fragte ich mich, wie lang ich schon festsaß.
Wochen.
Monate.
Ich konnte mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, aber es musste schon fast ein Jahr sein.
Das ich einmal so enden würde, hätte ich nie angenommen.
In meinem Zimmer, was ich schon die ganze Zeit bewohnte, gab es nur ein Bettgestell. Die Matratze war eingerissen und stahlharte Federn drückten mir jede Nacht schmerzlich in den Rücken.
Sonst existierte bloß noch ein alter Schrank, woran die Türen fehlten. Dort drin lagen meine wenigen Sachen.
Ich besaß nicht viel.
Rein gar nichts, außer etwas, was mir wirklich wichtig war.
Mein Blick fiel unverzüglich auf einen Karton, der darauf lag.
Das einzig Persönliche, was mir von meinem Leben überhaupt noch blieb. Erinnerungen an eine Zeit, an die ich oft zurückdachte.
Das Einzige, was mich überhaupt tatsächlich noch denken ließ.
Rote Lackschuhe, die ich als sechzehnjähriges Mädchen zum Abschlussball trug.
Zugleich schloss ich die Augen und Bilder von tanzenden Paaren bewegten sich durch meinen Kopf.
Lachende Gesichter.
Fliegende wunderschöne Kleider.
Gedämmtes Licht.
Unzählige Kerzen, die den großen Saal in ein wunderschönes Orange tauchten.
Es waren Gedanken, die mich auf der einer Seite glücklich machten, aber nur ein Paar Stunden später; zerstörten sie mein Leben komplett.
An diesem Tag sah ich das letzte Mal meine Eltern.
Nach der Scheidung hatten sich beide extrem verkracht, aber es war mein sehnlichster Wunsch, dass wir diesen besonderen Moment gemeinsam verbrachten. Wir hatten viel gelacht, so als wäre alles wieder… wie immer.
Das Gekicher meiner Mutter verblasste, als ich die Lider wieder öffnete und mein Blick auf die dunkelgrauen Wolken schweifen ließ.
Sie war so schön gewesen. Ich hatte viel von ihr geerbt. Die dunkelbraunen vollen langen Locken, die nun matt an mir herunterhingen. Die eigentlich strahlend meerblauen Augen, die bei mir nur noch ausgelaugt wirkten.
Das Kleid, was ich an diesem Abend trug war wunderschön.
Zu diesem Zeitpunkt zwar das Wetter schlecht, aber das vermieste niemanden die Laune. Ganz im Gegenteil. Auch nicht, als ich nach beiden Ausschau hielt, dass sie mich wieder abholten.
Noch heute weiß ich genau, wie ich verloren am Straßenrand wartete. Alle anderen fuhren nach Hause, aber ich stand einfach nur mutterseelenallein da, doch keiner tauchte auf. Niemand tat es.
Mittlerweile goss es wie aus Eimern. Das Kleid war im Eimer. Meine Haare hingen nass und fahl nach unten.
Auf Anhieb wusste ich ganz genau, dass etwas passiert sein musste; dennoch wartete ich weiter, in der Hoffnung, dass ich mich bloß täuschte.
Leider kam es nicht so.
Ich besaß Recht.
Irgendwann entschloss ich mich dann doch mitten in der Nacht nach Hause zu laufen. Alles war düster, als ich ankam.
Leer.
Beruhigend sog ich den vertrauten Duft meiner Familie in die Nase, aber als Minuten später zwei Cops vor unserer Haustür auftauchten, war mir alles klar.
Sie waren auf dem Weg zu Schule von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt.
Es gab Momente, da hatte ich mir oft die Schuld an allem gegeben, denn wenn ich mir eine andere Fahrgelegenheit gesucht hätte, wären sie wahrscheinlich noch am Leben und ich nicht an diesem Ort.
Meinen Kopf legte ich leicht zur Seite und ich beobachte da diese Person.
Es war genau einundzwanzig Uhr.
Jeden Tag lief er dort unten mit seinem Dobermann lang. Er kam immer aus der gleichen Richtung, ging seine Runde mit dem Hund und schlenderte dann auch wieder an meinem Fenster vorbei. Egal bei was für einem Wetter.
Dieses Mal hatte er eine Kapuze auf dem Kopf, sodass ich seine satten blonden Haare nicht erkennen konnte.
Ich schätzte ihn in meinem Alter.
Irgendwie freute ich mich ihn immer zu sehen und war auch zu dieser Uhrzeit ständig am Fenster, um durch die Scheibe zu blicken.
Ich schluckte.
Wie gerne hätte ich dem Tier durch das kurze Fell gestrichen.
Wann hatte ich überhaupt das letzte Mal einen Hund berührt?
Nicht einmal daran konnte ich mich erinnern und ich verbiss mir die aufsteigenden Tränen.
Ich hatte viel geweint, geschrien, gebetet und nichts brachte etwas.
Vielleicht war das auch die Quittung dafür, dass ich meine Eltern irgendwo doch auf dem Gewissen hatte.
Ich wusste es nicht, denn danach packte ich einfach so meine Tasche und verschwand.
Mit Gelegenheitsjobs hielt ich mich über Wasser und suchte mir nicht nur die falschen Leute, sondern auch den falschen Freund.
Plötzlich hörte ich das Geräusch schwerer Stiefel und zuckte hart zusammen.
Unwillkürlich begann mein Körper zu schaudern und mein Blick fiel zu der verschlossenen Tür.
Ich hatte Angst. Es war sogar mehr als das. Einfach nicht zu beschreiben.
Augenblicklich presste ich die Lider zu zusammen und hoffe, dass er nicht in mein Zimmer kommen würde. Es war schon kaum zu ertragen, dass er mich ohne einen ersichtlichen Grund einsperrte, aber wenn er kam, dann hieß das häufig nichts Gutes.
Meine Fäuste presste ich steif zusammen, sodass mir meine Nägel in die Handflächen bohrten.
Es schmerzte, aber somit versuchte ich einen klaren Gedanken zu fassen und mich nicht von der Furcht verschlucken zu lassen.
Schritte, die immer lauter wurden, stoppten kurz darauf genau vor meinem Zimmer.
Als sich der Schlüssel begann zu drehen, hörte man ein leises Klacken, aber für mich war es ohrenzerreißend.
Ich fokussierte das Metall und sah in dem kleinen Loch sogar von da aus, wo ich stand, wie sich etwas bewegte.
Verschreckt schob ich meinen Körper weiter in die Ecke des Fensterstockes, kauerte mich darauf und zog die Beine an.
»Bitte. Bitte. Bitte. Hab keine schlechte Laune.«, hauchte ich leise, doch meist entsprach genau das nicht der Tatsache.
Mein Atem beschleunigte sich immer mehr, bis ich dachte zu hyperventilieren.
Als dann das Holz aufschwang und die Klinke hart gegen die Wand schepperte, zuckte ich schwer zusammen und hielt komplett die Luft an.
Seine Gestalt lehnte sich gegen den Rahmen und er verschränkte die Arme ineinander, wobei seine braunen Augen mich intensiv betrachteten.
Unwillkürlich kullerte ich mich weiter zusammen; presste mich stärker gehen den rauen Putz, als könnte ich darin verschwinden.
Warum passiert das mir?
Wieso muss ich da durch?
Diese Fragen stellte ich mir jeden Tag, aber ich bekam selbst darauf keine Antwort.
Ich wusste nur, dass er nach der Arbeit in seiner Stammkneipe war. So wie eigentlich immer.
Das Halfter seiner Dienstwaffe hing noch am Gürtel seiner Jeans und ich sah klar und deutlich die schwarze Pistole. Er hatte sich nicht einmal richtig ausgezogen, also war mir schon mehr als bewusst, dass er noch schlechtere Laune, als sonst; hatte.
Meine Kehle wurde sofort trocken.
Ich wollte etwas sagen, aber schaffte es einfach nicht. Außerdem brachte es nicht viel.
Mason war nicht immer so. Ganz im Gegenteil. Er holte mich damals aus meinem tiefen Loch heraus, in dem ich zwei Jahre steckte, bevor ich doch noch richtig abrutschte und auf der Straße landete. Er hatte mich bei einem Drogeneinsatz aufgegabelt und angeboten mir zu helfen. Wir verliebten uns.
Das ging ein Jahr lang gut, bis er zu einem Einsatz fuhr.
Dort musste irgendetwas passiert sein, aber ich erfuhr niemals genaueres.
In dem Moment fing dann alles an.
Urplötzlich sperrte er mich auf den Dachboden. Natürlich ließ ich mir das nicht bieten, aber für jeglichen Widerspruch wurde ich regelrecht mundtot gemacht.
Am Anfang flehte ich ihn an mir zu sagen, was passiert sei. Wollte, dass er mit mir sprach und das wir alles wieder hinbekamen, auch wenn ihn die Hand ausrutschte, aber es wurde von Tag zu Tag immer schlimmer.
So schlimm, dass er ständig trank.
Das er überhaupt noch seinen Job besaß, wunderte mich, doch meist am Morgen verließ er das Haus, als wäre alles in Ordnung.
Ich hatte ihn geliebt. Ich hatte es wirklich. Irgendwann einmal. Allerdings verschwand das Gefühl schon vor langer Zeit.
»Kaitlyn!«, hörte ich schlagartig meinen Namen und zuckte zusammen, schaute ihn mit schreckgeweiteten Augen an und wusste nicht, was nun kam.
Er hob eine dunkle Braue und sah mich von oben bis unten an.
»Komm!«, sprach er und winkte mich zu sich.
Allerdings schien ich mit der Ecke zusammengewachsen zu sein.
»Mach gefälligst, was ich dir sage.«
Seine Stimme war ruhig, aber mit einem gewissen Unterton.
»Du willst doch nicht, dass ich sauer werde, oder? Also komm her.«
Unsicher tapste ich dann doch langsam mit nackten Füßen über das Linoleum in seine Richtung.
Dort angekommen, riss er mich auch schon prompt am Arm zu sich und ohne ein weiteres Wort zog er mich ins Badezimmer nebenan.
»Geh duschen. Du stinkst. Ich habe dir saubere Unterwäsche hingelegt.« und mein Blick fiel auf den Klodeckel.
Schwarze Spitze.
Ich wusste, was kam und stand kurz vor einem Heulkrampf, aber er stieß mit den Handballen gegen meinen Rücken, sodass ich weiter in das Badezimmer taumelte.
Natürlich schloss er die Tür zugleich von außen zu. So wie immer.
»In einer viertel Stunden bist du fertig. Keine Minute länger. Deine Zeit läuft.«
Dann hörte man ihn auch schon wieder die Treppe nach unten stampfen.
Bebend zog ich mir meine Jogginghose von der Haut, sowie mein Shirt und stand auch schon binnen weniger Sekunden unter dem Strahl.
Es war fast ekelhaft, dass ich, wenn es hoch kam; nur einmal in der Woche duschen durfte, doch man gewöhnte sich an alles.
Sofort seifte ich mich ein, wusch meine Haare und machte mich richtig sauber, auch wenn ich wusste, was mir bevor stand.
Ich beeilte mich extra, sonst wäre ich definitiv erfroren.
Das Wasser war eiskalt und die Gänsehaut auf meinem Körper war kaum zu ertragen.
Meine Zähne klapperten und mit bebenden Fingern ergriff ich kurz darauf ein Handtuch und trocknete mich eilig ab.
Unvermittelt hustete ich auf.
Das hatte ich in letzter Zeit häufig. Hoffentlich bekomme ich nicht noch eine Lungenentzündung, dachte ich, aber auch dann, wäre ich ihm scheinbar egal gewesen.
Das mich Mason nicht einfach gehen ließ, konnte ich nicht verstehen. Er beantwortete mir auch die Frage nicht, obwohl ich ihm diese oft genug stellte.
Irgendwann gab ich es dann auch auf.
Am Anfang wehrte ich mich gegen alles, versuchte irgendwie abzuhauen. Ich schaffte es nicht.
Niemals.
Alle spitzen Gegenstände, womit ich mich verletzten konnte, entwendete er.
Es war wie ein Alptraum, aus dem ich wahrscheinlich nie wieder erwachte, dabei hoffte ich noch immer, dass mir irgendjemand half, doch wie, wenn mich niemand vermisste?
Mit zitternden Fingern ergriff ich die schwarze Unterwäsche und zog mir diese über meinen ausgekühlten Körper.
Noch ein kurzer Blick in den Spiegel, der mich schon fast erschrecken ließ… Meine Augenringe waren tief und dunkel. Nichts war mehr vor mir übrig geblieben.
So wie ich mich innerlich fühlte, sah ich auch aus.
Einfach nur total schrecklich.
Das Gesicht eingefallen und schlecht.
»Bist du fertig?«, hörte ich Mason auf der Hälfte der Treppe und kurz darauf öffnete er auch schon die Tür, zog mich ruckartig nach draußen und musterte mich mit seinen gierigen braunen Augen.
Ich hingegen wendete mein Gesicht ab und biss hart die Zähne aufeinander, sonst hätte ich wahrscheinlich einen Brechreiz bekommen.
»Los komm mit.«
Er führte mich allerdings nicht in sein Zimmer, wie so oft, sondern schubste mich wieder unsanft in meines.
Ich bekam immer mehr Schiss.
Vor allem, weil es nicht typisch war. Das hieß nämlich bloß, dass ich für ihn die Beine breit machen sollte und er danach seine Wut wieder einmal an mir ausließ.
Unsanft schmiss er mich auf meine Matratze. Das Bett gab unter mir nach und quietschte, bei meinen hastigen Bewegungen nach hinten.
Selbstverständlich machte ich das, was jeder Mensch in Angst tat…
Ich versuchte das Weite zu suchen, auch wenn es nicht viel brachte, denn mit einem schmerzhaften Ruck, umschloss er meinen linken Knöchel und riss mich wieder zurück, sodass ich mich auf dem Rücken befand.
»Wo willst du denn hin?«, knurrte er.
»Lass mich bitte.«, hauchte ich.
Meine Stimme war brüchig und kaum hörbar.
Ich hatte seit Wochen nicht mehr richtig gesprochen. Mit wem auch?
Kurz darauf hörte ich seinen Gürtel klappern und sprang sofort nach oben, um mich in eine Ecke des Zimmers zu verziehen.
»Kannst du mir mal sagen, was die Scheiße soll?«, schnauzte Mason, warf seine Hose auf den Boden und eilte zu mir, doch ich wisch ihm gezielt aus.
Ich konnte einfach so weitermachen.
Normalerweise ließ ich immer alles über mich ergehen, aber ich schaffte das alles nicht mehr. Ich ertrug das nicht.
Am liebsten wäre ich aus dem Fenster gesprungen. Gleich Kopf über, sodass ich mir das Genick brach und endlich von diesem Ort verschwand. Leider waren die Gitter davor viel zu stabil um wegzukommen und das Fenster zugeschlossen.
Als ich schon einmal das Glas zerbrach und hinausschrie, half mir auch keiner und im Enddefekt prügelte mich Mason halb tot, doch in dem Moment wollte ich genau das.
Er sollte es tun, damit ich das endlich weg kam.
»Kaitlyn!«, keifte er nun und der Geruch von Whisky strömte mir entgegen.
Unwillkürlich versuchte ich ihm erneut zu entwischen, dennoch schnappte er sich meine nassen Haare, riss mich nach hinten und drückte mich mit dem Gesicht gegen die Scheibe des Fensters.
Dass es niemand interessierte, dass ich feststeckte und das mich keiner hörte, war mir bewusst, aber ich trommelte trotz dessen dagegen, woraufhin er meinen Schopf zurück zog und den Kopf gegen die Scheibe drosch.
Sofort pulsierte meine Schläfe.
Das Glas verfärbte sich rot und ich presste die Lider zusammen.
Als ich sie wieder öffnete, wurde ich auch schon nach hinten gerissen. Das einzige, was ich noch wahr nahm, waren die düsteren regnerischen Wolken und den junge Mann mit seinem Hund auf dem Gehweg, der plötzlich nach oben schaute und begann zu kläffen.
Dann drehte er sich zu mir und sogar von dort oben, konnte ich seine hellen grauen Augen erkennen.
Ich hatte nicht einmal Zeit, um mich selbst zu fragen, ob der Fremde mich vielleicht doch bemerkt hatte.
Sein Hund tat es auf jeden Fall.
Schlagartig wurde ich weiter zurückgerissen und gegen die Wand geschleudert.
Geräuschvoll schlug ich dagegen und alle Luft aus meiner Lunge strömte nach draußen.
»Nein!«, rief ich, als Mason mir gewaltsam zwischen die Schenkel griff und mich versuchte auf das Bett zu zerren.
Das Bellen nahm ich nebenbei noch immer wahr.
Dieses Tier schien meine einzige Chance zu sein und plötzlich schöpfte ich neue Hoffnung.
Meine Augen sahen sehnsuchtsvoll zu der Tür, die noch immer einen Spalt offen stand. Ich würde es schaffen. Entweder kam ich raus oder ich musste ihn dazu bringen, mich zu töten.
Hauptsache ich war von dort weg.
Ich trat unvermittelt zu und schlug fester um mich, erwischte ihn genau zwischen den Beinen, woraufhin er sich schmerzverzerrt die Eier hielt und zusammenkauerte.
Er wollte mich noch am Bein festhalten, aber ich krabbelte wie eine Irre von der Matratze herunter, ein Stück über den Fußboden und hetzte durch den oberen Flur.
Alles geschah wie in Zeitlupe.
Ich dachte an nichts mehr, eilte um die Ecke und traf mit meinen nackten Füßen die frischen karrenden Stufen.
Ich musste einfach weg und als ich unverhofft einen lauten Schuss hörte, erst recht.
Wahrscheinlich dachte er mich damit einzuschüchtern, aber lieber war ich tot, anstatt weiterhin in dieser Hölle zu sitzen.
»Bleib stehen du Miststück!«, brüllte es; das Kläffen des Hundes immer lauter.
Er war noch da.
Hoffnungsvoll riss ich am Knauf der Haustür, als diese wirklich aufsprang.
Kalte Luft strömte mir auf die Haut.
Der Regenguss traf sofort mein Gesicht und ich rannte auf den Asphalt, blickte mich hetzend nach links und rechts um und dann geradeaus.
Da stand er mit dem Handy am Ohr, schaute mir direkt in die Augen und sprach dann noch aufgeregt ein paar Worte.
»Hilf mir!«, schrie ich laut, stürmte zu ihm hin, wobei er auch schon schützend seine Arme ausbreitete.
Die hellen Augen musterten mich besorgt; flogen über meine fast nackte Haut. Ich hingegen klammerte mich so fest, wie ich nur konnte, an seinen muskulösen Körper.
Er war meine Rettung und ich wusste mit Sicherheit, dass das endlich die Kehrwendung meines Lebens sein würde.
Ende